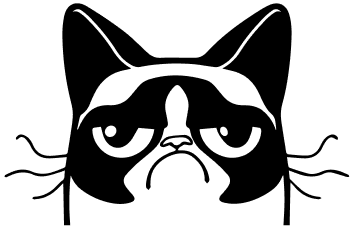Text: Sofia Hoffmeister / U21-Team
Ich trage dieses Unbehagen schon länger mit mir rum. Doch seit einigen Wochen, seitdem der Sommer, die Unbeschwertheit und Leichtigkeit anscheinend wieder zurückgekehrt sind, ist dieses Gefühl in mir lauter geworden.
Unbehagen
Seit Beginn der Pandemie und den mit ihr einhergehenden Einschränkungen stand ich ständig im Zwiespalt mit mir selbst. Soll ich diese Person jetzt wirklich umarmen oder es bei einem Zunicken und einer Begrüßung belassen? Sollte ich mich überhaupt mit irgendwem außerhalb meines Haushalts treffen, auch wenn es nur ein harmloser Spaziergang an der frischen Luft ist? Fragen in der Art haben wir uns alle bestimmt in den vergangenen Monaten öfters gestellt. Ich mir auch, und dennoch hatte ich bei jedem Mal mehr trotzdem keine Antwort darauf. Auf der einen Seite stand die Rationalität und der Anspruch der Verantwortung an einen selbst, alles richtig machen zu wollen, solidarisch zu sein, mitzuhelfen die Pandemie einzudämmen und auf der anderen Seite gleichzeitig zu wissen, dass einem in diesen harten Wintermonaten in Isolation eine Umarmung zwischendurch sicherlich gut täte. Nur so als Beispiel. Also fing ich an, den Fragen aus dem Weg zu gehen, um nicht länger zu versuchen, sie zu beantworten. Der für mich naheliegendste Weg war eine völlige soziale Isolation. Umso paradoxer, dass ich mich trotzdem jeden Tag in die Schule schleppen musste. Zum Zeitpunkt der zweiten Welle gefühlt der einzige Ort, an dem Menschen überhaupt noch aufeinander trafen.
Ich erinnere mich, wie ich anfing meine Mittagspausen komplett alleine zu verbringen. Ich sah keinen Sinn darin, dass wir im Schulgebäude einander ausschließlich mit Masken begegnen sollten, dann aber in der Einkaufsstraße um die Ecke unsere Döner-Boxen nebeneinander auf einer Bank verzehrten. Auch nach der Schule führte mein Weg stets direkt nach Hause. Keine Abstecher zu Freund*innen. Ein paar Wochen nachdem ich diese „Regelung“ so für mich eingeführt habe war meine Freundesgruppe dabei, auf WhatsApp eine Überraschungsparty im kleinen Rahmen (4-5 Leute) für eine Freundin zum Geburtstag zu organisieren. Ich sagte ab. Erlaubte mir aber eine Woche später für meinen eigenen Geburtstag zu einer Freundin nach Berlin zu fahren, wo wir den Abend zu dritt verbrachten. Auf dem Rückweg im ICE ging es mir richtig schlecht. Ich machte mir krasse Vorwürfe, weil ich meine Linie nicht konsequent durchziehen konnte. Warf mir, wie ich bis heute immer noch finde, berechtigterweise Egoismus vor. Das war der erste Knackpunkt, an dem ich die Ambivalenz in mir selbst nicht aushielt, sie sogar hasste.
Was ist schon Normalität?
Diese Ambivalenz hat mich seither nicht verlassen, weswegen ich während der dritten Welle noch stärker darauf achtete, niemanden außerhalb meines Hausstandes zu sehen, wenn es nicht nötig war. Auch wenn ich gleichzeitig wusste, dass das an meiner mentalen Gesundheit kratzen würde. Seit ein paar Wochen scheint sich die pandemische Lage zu verbessern (Delta-Variante ausgenommen). Der Sommer ist wieder da und die aktuellen Verordnungen lassen sogar wieder kulturelle Veranstaltungen zu, auf die ich so sehr hingefiebert hatte. Eine von diesen Veranstaltungen, ein Konzert mit Hygienekonzept, besuchte ich in der ersten Juniwoche.
Kurzer Disclaimer vorab: Es ist in keinster Weise mein Ziel die Veranstalter*innen an den Pranger zu stellen. Mitleid will ich auch nicht. Ich möchte lediglich schildern, was an dem Abend in mir vorging.
Ich blicke auf den Abend mit gemischten Gefühlen zurück. Es war mein erstes Konzert, wenn auch kein richtiges, seit über acht Monaten. Natürlich überwog auf dem Weg dorthin Vorfreude und Aufregung. Während der Veranstaltung allerdings gaben sich dann doch einige Besucher*innen so sehr dem Moment hin, dass sie ihre fest zugewiesenen Plätze ohne Maske verließen und sich in Richtung Bühne bewegten, um dem „echten Konzerterlebnis“ buchstäblich näher zu kommen. Das mag jetzt hochgradig lächerlich klingen, aber zu sehen, wie Menschen ohne Maske vor mir eng aneinander tanzten hat mich in dem Moment so wütend gemacht, dass ich ab der Sekunde den Live-Auftritt nicht mehr genießen konnte und wie gelähmt dastand. Das Konzert wurde schlussendlich zwei Songs vor Ende wegen Nicht-Beachtung des Hygienekonzepts einiger Teilnehmer*innen auch abgebrochen.
TW: Angstattacke, Panikattacke
Auf dem Weg zum Ausgang merkte ich, wie meine Wut in Angst umschwang. Mein Puls wurde immer schneller, meine Kehle immer enger. Da war sich was am Aufbauen, ganz klar. Nur was genau, wusste ich nicht. Nach ca. einer Minute gab es kein Halten mehr: Mich holten Atemnot und weiche Knie ein. Ich konnte ohne Hilfe nicht mehr stehen, geschweige denn regelmäßig atmen. Zum Glück haben dann zwei Passantinnen mir dabei geholfen, aus meiner Hyperventilation wieder in eine regelmäßige kontrollierte Atmung zu kommen. Dieser Vorfall hat mich die vergangenen Wochen viel beschäftigt.

Natürlich sehne ich mich nach Normalität. Nach Feierngehen, nach Konzerten, nach Stadienbesuchen – eben all dem, was die letzten beiden Jahre nicht in seiner ursprünglichen Form ging. Und es scheint so, als würden wir diesem Zustand langsam, aber sicher immer näherkommen. Trotzdem muss ich mir eingestehen, dass ich Angst vor dieser „Normalität“ habe, die ich mir seit Anfang der Pandemie eigentlich immer herbeigesehnt habe. Allein beim Gedanken daran inmitten einer tobenden Menschenmasse zu stehen, wird mir richtig unwohl. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal an den Punkt kommen werde, an dem ich einen Moshpit abturnend finden würde. Seit dem Tag ist es mir bewusst geworden, wie ich es in Worte fassen kann, was ich seit Beginn der Pandemie fühle. Es ist, als würde mir eine kognitive Dissonanz innewohnen.
Aller (Neu-) Anfang ist schwer
Abschließend sei gesagt: Wir täten gut daran Verständnis dafür aufzubringen, dass sich jede*r von uns in seinem eigenen Tempo wieder an die Normalität gewöhnen muss. Die Pandemie war eine neue Situation für uns alle, an die wir uns erstmal anpassen mussten. Die Rückkehr zur Normalität ist eine ebenso große emotionale Herausforderung, finde ich. Was für die einen zu schnell geht, ja sogar überfordernd ist, stellt für die anderen kein Problem dar, ist ein Rückgewinn der persönlichen Freiheit. Diese letzten zwei Jahre, die Kontaktbeschränkungen, die starke Einschränkung sozialer Interaktion sind an keinem von uns spurlos vorbeigegangen. Deswegen habe ich mir auch mittlerweile verziehen, dass ich das Gefühl habe, nicht von jetzt auf gleich direkt in einen unbekümmerten Modus wie andere in meinem Umfeld zurückswitchen zu können. Vielleicht werde ich länger brauchen als andere. Aber das ist vollkommen okay so. „Mach nichts, womit du dich nicht wohlfühlst“ ist ab jetzt meine Prämisse. Egal, ob es theoretisch mit den aktuellen Verordnungen vereinbar und somit erlaubt ist. Wichtiger ist, was mir mein Körper sagt und was mit meinen (moralischen) Vorstellungen vereinbar ist. Und wenn diese nicht das volle erlaubte Potential ausschöpfen wollen, dann ist das eben so.

(Presse-)Kontakt
Jana Gilfert
Kommunikation / Presse / PR
jana.gilfert@tincon.org
+49 172 443 62 69